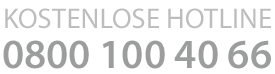Aktuelles und Typisierungsaktionen
Die Suche nach dem „genetischen Zwilling“
Ein informatives Interview unseres ärztlichen Leiters zum Thema "Suche nach dem genetischen Zwilling", das am 14. Februar 2017 in der Schwäbischen Zeitung erschien....
Ulm sz Rund 3500 Stammzelltransplantationen werden jedes Jahr in Deutschland vorgenommen, Tendenz weiter steigend. Im SZ-Interview erläutert Privatdozent Dr. Joannis Mytilineos, wie die Spenderdateien organisiert sind, welche Methoden der Transplantation es gibt und wie die Heilungschancen für Leukämiekranke stehen.
Herr Dr. Mytilineos, die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSSD) ist eine von mehreren Stellen, an denen potentielle Spender registriert werden. Wo werden die Daten zusammengefasst?
Im Zentralen Knochenmarkspenderregister Deutschland (ZKRD) werden alle bundesweit erfassten Daten anonymisiert zusammengefasst. Diese sind dann weltweit verfügbar. Das ZKRD hat seinen Sitz hier in Ulm im selben Gebäude wie die DSSD, ist aber komplett unabhängig von unserem Institut.
Wie viele Menschen haben sich bereits als Stammzellspender registrieren lassen?
Deutschlandweit nähert sich die Zahl der registrierten Spender der 7,2-Millionen-Marke, weltweit sind es aktuell etwa 28 Millionen. Deutschland spielt in diesem Zusammenhang also eine große Rolle.
Welche Rolle spielte der Standort Ulm beim Aufbau der Spenderdateien?
Ulm war schon immer sehr involviert in diese Entwicklung. Die erste Stammzell-Transplantation Deutschlands ist hier durchgeführt worden, und auch der erste nichtverwandte Spender bundesweit war aus Ulm. Anfangs hat man die Daten der potentiellen Spender nicht in standardisierten Dateien festgehalten, sondern es gab Blutspender, die typisiert waren für andere Zwecke, und unter diesen Leuten hat man dann Knochenmarkspender gesucht. In Deutschland war Ulm eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Stelle, die mit der Organisation der Daten angefangen hatte.
Wenn also ein Stammzellspender für einen Patienten gesucht wird – egal, ob aus Deutschland, den USA oder Australien – geht die Anfrage auch an das ZKRD?
Genau. Die internationalen Netzwerke sind mittlerweile sehr ausgeklügelt. Die Informationen werden vom ZRKD so aufbereitet und den Sucheinheiten sowie den Kliniken zur Verfügung gestellt, dass diese genau sagen können, welchen Spender mit welcher Typisierung sie haben wollen. Die ganze Abwicklung läuft dabei über das zentrale Register.
Das Ziel bei der Auswahl ist also primär, dass man den optimalen Spender, quasi einen „genetischen Zwilling“, findet?
Das Ziel ist, einen mit dem Patienten möglichst identischen Spender zu finden. Je höher die Kompatibilität ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Transplantation erfolgreich ausgeht. Das Problem ist dabei weniger, dass das Transplantat abgestoßen wird – das passiert eher in der Organtransplantation. In der Stammzell-Transplantation ist das wesentlichere Problem die umgekehrte Abstoßung. Das Immunsystem, das durch die transplantierten Zellen aufgebaut wird, erkennt den Gastorganismus (also den des Patienten, Anm. d. Red.) als fremd und greift ihn an. Deshalb ist man bemüht, möglichst identische Kombinationen zwischen Spender und Empfänger zu haben.
Wie viele Neuerkrankungen an Leukämie gibt es in Deutschland jährlich?
Es gibt ungefähr 10 000 Neuerkrankungen jährlich. Das erklärt auch, warum man so viele Spender braucht. Von 100 Menschen, die sich registrieren lassen, wird im Durchschnitt einer im Lauf seiner Zeit als registrierter Spender um seine Hilfe gebeten.
Wann kommt die Transplantation infrage?
Glücklicherweise kann man einige Leukämieformen durch Chemotherapie gut beherrschen. So kann die Chronisch Lymphatische Leukämie, die früher eine Standardindikation für eine Stammzelltransplantation darstellte, inzwischen bei über 90 Prozent der Patienten erfolgreich mit Medikamenten behandelt werden. Eine Akute myeloische Leukämie (AML) beispielsweise ist die klassische Standardindikation für eine Transplantation. Auch hier gibt es wieder Untergruppen in Hoch- und Niedrigrisiko, und wenn man die Klassifizierung zu der Risikostufe möglichst früh schafft, weiß man auch, welchen Weg man gehen muss. Bei einer Hochrisiko-AML würde man sofort nach einer initialen Chemotherapie eine Stammzelltransplantation durchführen. Sobald die Leukämieblasten aus dem Blut verschwunden sind, würde man transplantieren, da man festgestellt hat, dass man dadurch die besten Ergebnisse erzielen kann.
Birgt die Transplantation für den Patienten auch Risiken?
Eine Stammzelltransplantation ist kein Zuckerschlecken. Üblicherweise geht der Transplantation eine Chemotherapie voran, die das eigene Knochenmark verdrängt und die Leukämiezellen komplett verschwinden lässt. Das ist eine schwere Sache, und wenn der Allgemeinzustand des Patienten nicht gut ist, kann er daran auch sterben. Das ist auch der Grund, warum man früher gesagt hat, dass jemand über 40 Jahre nicht transplantationsfähig ist. Mittlerweile sind die Verfahren so fein justiert und ausgeklügelt, dass man keine wirkliche Altersgrenze hat. Ob transplantiert wird oder nicht, hängt also in erster Linie vom Zustand des Patienten ab und nicht von seinem Alter.
Wie viele Transplantationen werden jährlich in Deutschland durchgeführt?
In Deutschland sind es jährlich knapp 3500, davon kommt bei rund einem Drittel der Spender aus dem Verwandtschaftskreis, der Rest sind Fremdspender. In Ulm sind es zwischen 50 und 70 Transplantationen jährlich.
Die Chancen, den passenden nichtverwandten Spender zu finden, liegen bei 1:1.000.000. Wie haben sich die Chancen auf eine Transplantation in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?
Anfangs war die Chance, einen nichtverwandten Spender zu finden, verschwindend klein, weil es nur wenige tausend Registrierungen gab. Aktuell ist man in Deutschland in der Lage, für knapp 75 Prozent der Patienten einen voll kompatiblen Spender zu finden, für weitere 20 Prozent einen weniger optimalen Spender, der aber immer noch akzeptabel ist. Es sieht also gut aus, aber nicht perfekt.
Welche Alternativen gibt es für die anderen fünf Prozent?
Zu den neuen Entwicklungen zählt die sogenannte haploidente Transplantation. Hierbei kann man durch ein bestimmtes therapeutisches Schema für Patienten ohne vollidentischen familiären oder akzeptablen nichtverwandten Spender auch einen familiären Spender nehmen, der nur halbidentisch ist – Mutter, Vater oder Geschwisterteil. Das funktioniert zwar recht gut, aber das Risiko einer umgekehrten Abstoßungsreaktion ist etwas höher. Leider gibt es natürlich auch Betroffene, die nicht einmal hierauf zurückgreifen können. Das ist im Einzelfall dann sehr tragisch.
Welche Bedeutung kommt der Therapie mit Nabelschnurblut zu?
In Deutschland ist die Nabelschnurtransplantation keine Erfolgsgeschichte. Da die Spenderdateien so viel Aufbauarbeit geleistet haben, war die Versorgung mit nichtverwandten Stammzellspendern in Deutschland immer überproportional gut im Vergleich zu anderen Ländern. Der Erfolg einer Transplantation ist auch davon abhängig, wie viele Zellen man in dem gewonnenen Präparat hat. Das Nabelschnurtransplantat kommt von Neugeborenen, da ist traditionell nicht so viel Blut drin und somit auch nicht so viele Zellen. Für einen erwachsenen Menschen ist das grenzwertig.
Könnte man diese Stammzellen nicht auf Nährböden vermehren?
Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Es könnte dabei zu Verunreinigungen kommen und ist auch technisch nicht so umsetzbar. Man hat auch schon mehrere Präparate gemischt, um die erforderliche Anzahl an Stammzellen zu erhalten, aber das hat sich auch nicht durchgesetzt, weil die Zellen sich dann gegenseitig bekämpfen könnten im Körper.
Der weitere Aufbau der Spenderdateien ist also nach wie vor unerlässlich?
So ist es. Am idealsten sind immer noch familiäre oder kompatible Fremdspender. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, dass sich immer mehr Menschen registrieren lassen, denn die jetzt bereits in den Spenderdateien vorhandenen werden irgendwann ja auch zu alt sein. Die Altersgrenze fürs Spenden beträgt 60 Jahre, und jüngere Menschen sind für eine Stammzellentnahme am besten geeignet. Die ständige Erneuerung der Dateien ist daher sehr wichtig.
Welche Verfahren gibt es, um Stammzellen für die Transplantation zu gewinnen?
In 80 Prozent der Fälle werden periphere Stammzellen entnommen, das heißt, in einer Art Blutwäsche werden die Zellen aus dem Blut des Spenders herausgefiltert. Bei 20 Prozent wird Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen.
Wovon hängt es ab, ob eine periphere Stammzellspende oder Knochenmark angefragt wird?
In der Regel wird für Kinder Knochenmark angefordert, weil von diesem eine geringere GVH-Reaktion ausgeht, also die umgekehrte Abstoßungsreaktion, bei der das Transplantat den Empfänger angreift. Auch gibt es bestimmte Erkrankungen, bei denen das Abstoßungsrisiko höher ist, daher nimmt man in diesem Fall ebenfalls lieber eine Knochenmarkspende. Aber letztendlich entscheiden zwei Gründe: Kommt der Spender überhaupt aus medizinischer Sicht für eine Knochenmarkentnahme infrage? Und dann zählt natürlich auch der Wille des Spenders. Wenn dieser das Risiko einer Narkose nicht eingehen will, entnimmt man eben periphere Stammzellen.
In der Anfangszeit der Stammzelltransplantation gab es nur das Verfahren der Knochenmarkentnahme ...
Die periphere Stammzellentnahme wird seit rund 15 Jahren eingesetzt, und man hat seither viele Erfahrungswerte sammeln können. Sie hat in weiten Teilen die Entnahme von Knochenmark ersetzt, weil sie einfach schonender ist. Der Spender muss auch keine Narkose über sich ergehen lassen. Wo auch immer möglich, setzt man diese Art der Spende ein.
Kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, jemanden mit den gleichen Gewebemerkmalen zu finden, in näherem Umfeld höher ist als zum Beispiel auf einem anderen Kontinent?
Statistisch gesehen schon. Wenn Sie einen Patienten mit einem asiatischen Hintergrund haben und hier in Deutschland einen Spender suchen, haben Sie vermutlich ein Problem, weil die Gewebemerkmale schon sehr unterschiedlich sind. Je größer die genetische Distanz ist, desto unwahrscheinlicher ist es, innerhalb der Datei einen Spender zu finden.
Wenn in Amerika jemand an Leukämie erkrankt und ein Spender für ihn in einer deutschen Datei gefunden wird, hat der Betroffene also vermutlich familiäre Wurzeln in Deutschland …
So ist es. Daran erkennt man auch die Völkerwanderungen; das ist unglaublich spannend.
Macht die Digitalisierung der globalen Welt den Zugriff auf die passenden Gewebemerkmale einfacher als noch vor 20, 30 Jahren?
Die Entwicklung, die es in der Stammzell-Transplantation gegeben hat, und die Möglichkeit, auf Spender anderer Länder und Kontinente zuzugreifen, wäre ohne die Digitalisierung nicht so möglich gewesen. In den Anfangszeiten gab es auch Spenderdateien in unterschiedlichen Ländern, und eine Stelle in Holland versuchte, diese Daten zusammenzusammeln. Damals musste man eine Diskette schicken mit den Daten, dann hat man diese Daten per Diskette zusammengemixt und ein Telefonbuch daraus gemacht. Wenn man einen Spender gesucht hat, musste man in diesem Telefonbuch nach den Typisierungen suchen. Das war sehr langwierig und umständlich. Durch die Digitalisierung geht das alles sehr viel schneller, und man gewinnt dadurch wertvolle Zeit.
Wie hoch ist die Chance auf Heilung durch eine Transplantation?
Leider ist es so, dass Patienten, die transplantiert werden müssen, ohne die Transplantation sterben – das ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die Chance ist hier gering. Die Chance einer Heilung bei erfolgter Transplantation hängt von mehreren Faktoren ab. Wenn man alle Patienten zusammennimmt, liegt die Quote bei knapp 60 Prozent. Aber man kann unterscheiden: Patienten, die in einer frühen Krankheitsphase transplantiert werden, haben ganz klar die besseren Karten als Patienten in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium. Es spielen aber auch andere Faktoren wie Alter, Gesamtzustand oder die genaue Art der Erkrankung eine Rolle.
Das heißt, dass jeder, der sich typisieren lässt, theoretisch einem an Leukämie erkrankten Menschen eine 60-prozentige Chance auf Heilung vermittelt?
Genau.
Heutzutage werden Registrierungsaktionen oft aufgrund von Einzelfällen initiiert und oftmals über die Social Media beworben. Gibt diese Art der Öffentlichkeitsarbeit einen Push bei den Neuregistrierungen?
Das ist sicherlich ein guter Weg, um das Thema publik zu machen und gerade auch jüngere Leute zu erreichen. Es ist aber nicht die Lösung aller Dinge. Ich habe ehrlich gesagt nicht erlebt, dass Facebook so extrem die Landschaft verändert hat. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Radio und Presse eine weitaus größere Rolle spielen.
Eine Typisierung kostet 50 Euro. Wer bezahlt das?
Die Spender werden nicht zur Kasse gebeten. Wir sind ja auf die jüngeren Spender angewiesen, und diese verdienen oft noch kein eigenes Geld. Daher sind wir sehr bemüht, auch Sponsoren zu finden. Manche Firmen initiieren eine Typisierungsaktion und übernehmen dann die Kosten. Auch kann man über elektronische Portale spenden. Oder ein junger Mensch fragt die Großeltern, ob sie die Kosten für seine Typisierung übernehmen.
Kann man sich im Rahmen einer Blutspendeaktion typisieren lassen?
Auch hier entstehen Kosten, die irgendwie abgedeckt werden müssen. Bei jeder Aktion gibt es daher ein Kontingent für zehn oder zwanzig Typisierungen, um die Kosten zu deckeln. Für Studenten beispielsweise wäre es aber sicher eine Möglichkeit, sich registrieren zu lassen. Einmal im Jahr führt die DSSD-Süd zusammen mit der Studentenvereinigung Uni-hilft eine kombinierte Blut- und Stammzellspender-Registrierungsaktion im Kampus der Uni Ulm durch.
Wenn man als Spender infrage kommt: Muss man selbst bei einer Stammzellentnahme mit Komplikationen rechnen?
Jeder Eingriff kann Nebenwirkungen haben, über die man aufgeklärt wird. Und dann kann der Spender immer noch abwägen, ob er dieses Risiko eingehen will. Wir sind allerdings der Meinung, dass das Risiko so gering ist, dass es verträglich ist. (bbr)